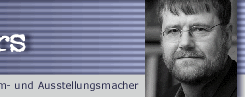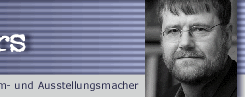| |
 |

|
 |
|
Ornament-Essay |
 |
Band 4
|
|
|
 |
|
|
Jens-Fietje
Dwars
Erfolg ist ein Irrtum
Reden, Essays und andere
Randbemerkungen
Mit einem Holzschnitt
von Albrecht Dürer
272 Seiten,
Fadenheftung im Festeinband,
kirschrotes Vor- und Nachsatzpapier,
ISBN 978-3-947646-27-2
EUR 22,00 EUR
Vorzugsausgabe: 65 bis 120 EUR,
je nach frei wählbarer Collage.
Zu bestellen beim
Herausgeber.
|
Der
Band vereint eine Auswahl von Essays aus drei Jahrzehnmten.
In Zwischentexten befragt der Autor seine eigenen Wortmeldungen
der Vergangenheit als Zeitzeichen: Was sagen sie über
jenen Zeitraum vielfacher Umbrüche als Epoche aus? Fragmente,
Bruchstücke, Wirklichkeitspartikel, lose verbunden, miteinander
verwoben durch wiederkehrende Motive. Von Kriegen ist die
Rede, von Bedingungen der Möglichkeit eines „ewigen
Friedens“, von bürger-
licher Weltsicht und den Widersprüchen der Marxschen,
von Höllen, die als Paradiese erscheinen, kurz: von den
Hoffnungen und Verbrechen des 20. sowie der Ratlosigkeit des
21. Jahrhunderts.
Motto des Bandes:
„… die müde Welt / Ist über diesen Dingen
eingeschlafen, / Die sie in ihrem letzten Kampf errang, /
Und hält sie fest. Wer sie ihr nehmen will, / Der weckt
sie auf. Drum prüf er sich vorher, / Ob er auch stark
genug ist, sie zu binden, / Wenn sie, halb wachgerüttelt,
um sich schlägt, / Und reich genug, ihr Höheres
zu bieten, / Wenn sie den Tand unwillig fahren läßt.“
(Friedrich Hebbel)
Das Buch erschien zum 65. Geburtstag des Autors. Einer Vorzugsausgabe
in 65 Exemplaren liegt je eine Collage des Autors bei. Eine
Übersicht der Collagen ist erhältlich unter: Kontakt.
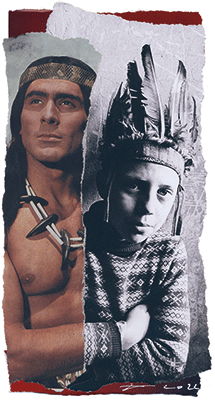
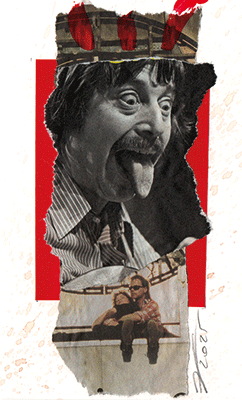

Von links nach rechts:
Was siehst Du, Bruder? (2022) / Hofnarr (2025) / Sprachlos
(2025)
|
|
|
 |
 |
|
Aus dem Nachwort:
„Nur, wer sich wehrlos
macht, wer seine Ratlosigkeit eingesteht und sich zu wundern
vermag über Dinge, die scheinbar jeder versteht, hat
die Chance, sie wieder und wieder anders zu sehen. Und vielleicht
brauchen wir dazu auch das ungenaue Sehen, den Blick durch
Milchglasscheiben, durch Scherben, in denen das Allzuklare
sich bricht.
Um die Metamorphose der Dinge wahrzunehmen, ihren Gestaltwandel
und unsere Versuche,
sich mit ihnen zu wandeln.“
|
 |
|
Die Presse urteilt:
Herz- und kopfhorchende Aufsätze: in über 30 Texten
der Roman eines philosophischen Denkens wider die Plapperei
der gelösten Zungen.
... Der Autor arbeitet gleichsam, im unentwegten Wechsel,
mit Fernrohr und Mikroskop. Heißestes Bemühn mit
kaltem Blick, auch auf sich gerichtet. Zu den aufregendsten
Essays gehört „Das Leben der anderen Anderen“:
ein Brief über Dwars‘ eigenes Schicksal zwischen
DDR und Westen; ein wahrhaftig nachgezeichnetes Labyrinth
aus Courage und Vorsicht, aus Träumen und Taktik, aus
wissenschaftlicher Leidenschaft und politischen Konsequenzen.
Ein Text, gestrickt aus Überzeugung und Verstrickung,
das Fluchwort heißt „Stasi“. Was bleibt,
nach 1990? „Unsägliche Trauer um die Vergeblichkeit
aller Mühen, sich verständlich zu machen.“
Der Autor ist hellsichtig, ohne zu triumphieren; er steht
aufrecht in störrischem Eigensinn. Der Ton ist mitunter
gezielt scharf, schroff. Etwa gegen „Stotterer der Geschichtsschreibung“,
die in Jahrestagen denken, nicht in Problemen, also Wieder-
und Übergängen.
Was hilft einem, der im verhallenden Wort lebt? Das Geschriebene?
Nein. Es hilft nur: schreiben. „Werden Bücher nicht
gelesen, möchte man verstummen vor Schmerz und sollte
dennoch weiterreden, immer genauer, konzentrierter, bis an
die Grenze zum Schweigen.“ Denn: Erfolg mag ein Irrtum
sein, das strebende Weiterschreiben nicht.
Hans-Dieter Schütt in: Neues Deutschland, 16.9.2025
Man merkt schon: Da beschäftigen Dwars noch viele nie
abgegoltene Diskussionen aus einem abgeschafften Land. Er
hat es nicht einfach wie ein altes Kleid an den Nagel gehängt.
[...] Es sind Texte der Suche, des Versuchens zu verstehen,
was da eigentlich geschehen ist mit der Welt, dem Land und
ihm selbst. Was natürlich immer ein produktiver Ansatz
ist: Die Gewissheiten der Vergangenheit immer wieder infrage
zu stellen. Heilige Kühe zu schlachten und Denkmäler
zu stürzen. ... es sind eigentlich die Ratlosigkeiten,
die geteilt werden müssen, nicht die Gewissheiten. Denn
nur dabei lernt man vielleicht was. Wenn man noch was lernen
will.
Ralf Julke, in: Leipziger Zeitung
|
 |
|
|
 |