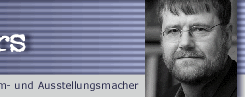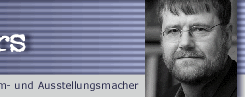|
Aus dem Nachwort
Der Titel „Über
das allmähliche Verfertigen von Welt im Dichten“
erinnert an einen älteren Text: „Über die
allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“.
Kleist hat den Aufsatz um 1805 geschrieben, aus seinem Nachlaß
wurde er 1878 zum ersten Mal veröffentlicht. Seit 1938
ist das Original verschollen, seit jenem Jahr, in dem Peter
Gosse in Leipzig geboren wurde.
Ein merkwürdiger Zufall. Man könnte meinen, der
Dichter sei zur Welt gekommen, um Kleists Idee zu leben: daß
wir unsere Meinungen und Vorstellungen von der Welt anderen
mitteilen sollten, um klare Gedanken daraus zu verfertigen.
Genau dies aber praktizieren die vorliegenden Texte. Der Autor
sucht das Gespräch mit Autoren und ihren Texten, die
ihm nahe sind. Zeitgenossen, Vorgänger, Ahnen, bis ins
ferne Indien, wo vor 3000 Jahren jemand eine Liebesgeschichte
besingt. Nichts davon ist veraltet, alles gegenwärtig,
denn Gosse lehrt uns das Lesen, er verrät die Betriebsgeheimnisse
der Dichter. Dichtung schafft keine Ersatzwelt, ist nicht
Sonntagsschmuck, um über die Notdurft des Alltags hinweg
zu helfen. Sondern Verdichtung des Bestehenden, Wahrnehmung
von Welt im Brennspiegel klarsten Sehens, bis zum Schmerzpunkt,
wenn wir wegschauen wollen. Gosse nun lehrt uns, wie sie das
machen, die Dichter, wie sie die Welt vor unseren Augen erstehen
lassen, wie sie uns nötigen, die Sinne zu schärfen
und genauer hinzusehen, hinzuhören. Wenn etwa Hölderlin
eine Idylle beschwört und sie zugleich im Mißton
des Versmaßes bröckeln läßt. Dann wird
die Belehrung zum Genuß, zur Entdeckung, die uns bereichert,
weil sie uns selbst ein eigenes Vermögen erschließt.
Und das wiederum zeichnet den wahren Lehrer aus.
Peter Gosse hat in den 1960er Jahren in Moskau Hochfrequenztechnik
studiert, war Ingenieur, bis er 1968 freier Autor wurde, Lyriker,
Nachdichter (auch in diesem Band!). Seit 1985 war er Lyrik-Dozent
am Leipziger Literaturinstitut, in den Umbruchsjahren 1992/93
kommissarischer Direktor.
Das Besondere seiner Dichtung, ihr Stil, liegt in diesen zwei
Polen begründet: eine überschießende Vitalität
auf der einen Seite, der Hunger auf Welt und die ebenso unstillbare
Sehnsucht, in sie überfließen zu wollen, und zugleich
die Präzision des Naturwissenschaftlers, des Technikers,
der noch das Überbordende abwägt und nüchtern
kontrolliert. Ihr Ausdruck: eine expressive Sprache, die lustvoll
ein Thema in Arabesken umspielt, neue Wörter erfindet
und sich scheinbar in Marginalien verliert, doch immer das
Ganze im Blick behält und die Auflösung einer Form,
ihr Zerfließen oder Zergliedern als neue Formgebung
meistert. Einfache Sätze werden so mit Sprengkraft geladen,
Thesen mit Antithesen gekoppelt. Und das alles auf engstem
Raum. Denn im Kleinen und Unscheinbaren verbirgt sich das
Große, im Mikrokosmos entdeckt Gosse das All, wie in
dem Kinderlied „Ich ziehe mit meiner Laterne“
die ersehnte Harmonie des Universums.
Die Essays dieses spätbarocken Expressionisten sind ein
hartes Brot, an dem sich Zuckermäuler die Zähne
ausbeißen. Wer jedoch Freude am kraftvollen Kauen hat,
der findet in dem Band nahrhafte Kost. Und die Zeichnungen,
die Volker Stelzmann extra dafür schuf, vollenden den
Genuß. 1940 in Dresden geboren, hat er an der Leipziger
Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und ab 1979
gelehrt. Seitdem sind der lyrische und der grafische Bildermacher
befreundet, auch wenn Stelzmann heute in Berlin lebt und wirkt.
Hier nun, im vorliegenden Band, ergänzen sie einander
aufs Schönste.
Leseprobe
Ich ziehe mit meiner
Laterne
Und meine Laterne mit mir.
Da oben leuchten die Sterne,
Hier unten leuchten wir.
Ein erstaunliches Gedicht, wie mir nach und nach aufgeht.
Es leitet die Schlußzeile nicht mit einem „Doch“
ein – „Doch unten leuchten wir“: eines solchen
Sich-an-die-Brust-Schlagens bedarf der Text nicht, in seiner
geradezu majestätischen und daher gelassenen Selbstsicherheit.
Er duldet und er wünscht, geduldet zu sein. Die Erde
erscheint weder herausgehoben noch zurückversetzt innerhalb
der Sterne, und so assoziiert sich mühelos ein solidarisches
Einander-gelten-Lassen Aller – ein redliches Weltbürger-Empfinden
ist hier dichterisch am Werke. Und eben indem dieses brüderliche
Tolerieren des Nächsten wie des Fernen, dieses Mögen
als höchstes Vermögen es nicht nötig hat, lauthals
mit der Tür ins Haus zu fallen, hören wir ja hin.
Anders gesagt:
Das Gedicht bietet sich dar ohne Ausrufezeichen, es trachtet
nicht danach zu bevormunden, zu übertölpeln. Es
redet nicht nur von brüderlichem Miteinander, es löst
dieses ein: indem es nicht belehrend über unsereinem
steht, sondern anheim stellend nebenan. Und was stellt das
Gedicht anheim? Ob wir seine heimelige Hochgestimmtheit annehmen
oder abweisen. Letzteres fällt schwer. Wahrscheinlich
auch deshalb, weil das Gebilde unscheinbar als ein Gelegenheitsgedicht
daherkommt und so nicht nur Universum und Erde, Finsternis
und Licht einander verbündet. Der Lampion, dieses schüttere
Faltpapier-Etwas an einem dünnen Stöckchen, verlebendigt
sich und hebt sich derart mir, dem Lebendigen, an die Seite:
Ich ziehe mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir.
Andeutungsweise zeigen diese wenigen Verse, was Dichtung sein
kann: Empfindungskorrelat des eigentümlich geschauten
und durchschauten Weltganzen und insofern dieses Weltganzen
Krönung. Indem Dichtung sowohl das Koma als auch dessen
buchstäblich Gegenläufiges, Amok, hinter sich lässt
oder balancierend gegeneinandertreibt in die gelassene Schwebe,
wächst sie ruhig aus dem Kern statt aufgeregt aus Randlagen.
Es versteht sich, daß das Ich im Laternengedicht zwischen
sich und die Welt, sich und die Menschheit keine Schranken
packen läßt, Grenzziehungen nationaler, konfessioneller
und was weiß ich welcher Art.
Es versteht sich auch, daß die Situationsbeschreibung,
um unangestrengt zu utopischer Verbrüderungsgeste zu
werden, das Zufällige, Unmaßgebliche tilgt. Keine
Attribute. Statt Geschehens Geschichte, statt Provinz Universum.
Pressestimmen
Michael Hametner: Peter
Gosses Essay-Sammlung (...) ist ein kunterbuntes, aber über
jede Farbe hoch gescheites Reden über die Welt der Dichtung
und der Dichter. Wie bei Pietraß ist das ja auch eine
Auswahl aus etwa 25 Jahren. Welche Nachrichten gibt’s
da für uns Leser?
Daniela Danz: Vielleicht
sind es nicht eigentlich Essays, es sind auch Anekdoten, die
berichtet werden, es sind Leseerfahrungen, sehr konkrete und
feine Leseerfahrungen, die könnte man Lehrern anempfehlen
und Studenten, um die Feinheiten der Gedichte wahrzunehmen.
Es werden auch Gedichte selbst, allein das ist schon sehr
interessant, schöne Gedichte selbst wiedergegeben.
Hametner: Und wir
erleben in diesem Band Gosse als einen hoch reflektierten
und hoch reflektierenden Dichter. Ist das eine Lektüre,
... wo man einen neuen Blick gewinnt?
Ulf Heise: Na
klar, das ist natürlich immer wieder sehr inspirierend
bei ihm, er kann das einfach auch sprachlich, wobei mich manchmal
ein bißchen gestört hat, muß ich der Ehrlichkeit
halber einwenden, daß es ein bißchen ins Manirierte
tendiert ..., aber nur sehr selten, –
Hametner: – Manchmal hat man das Gefühl, er weiß
zu viel –
Heise: – ja, es ist wirklich ein sehr intelligenter
Autor und er versucht das auch alles da rein zu packen, aber
es wird dann manchmal etwas überportioniert. Aber es
ist schon ein toller Blick, den er immer wieder vor allem
auf seine Kollegen von der Sächsischen Dichterschule
hat ... und dann natürlich die ganz vielen russischen
Autoren, die er vorstellt, er hat ja in Russland studiert
...
Bücherjournal, MDR-Figaro, 13. Juni 2013
Seine Essays vollziehen die Entstehung zumeist lyrischer Texte
bis in Wortwahl und Betonung nach. Mit dieser an Georg Maurer
geschulten Methode bleiben Gedichte für ihn stets lebendig,
mehr noch: Sie erstehen vor dem Auge des Lesers neu.
So bringt uns Peter Gosse mit der klaren Sicht des Naturwissenschaftlers
– er hat in Moskau Hochfrequenztechnik studiert –
und der Erfahrung des Lyrikers Dichtung nahe. Weit ist der
Bogen seiner Essays gespannt: von Walther von der Vogelweide,
Francesco Petrarca und Friedrich Hölderlin über
Walt Whitman, Sergej Jessenin, Pablo Neruda, Rafael Alberti,
Nazim Hikmet, Erich Arendt bis hin zu Róža Domašcyna
und Thomas Rosenlöcher. Durch sein Studium in Moskau
und seine genaue Kenntnis der russischen Sprache stehen ihm
Jewgeni Jewtuschenko, Raïssa Achmatowa, Juri Dombrowski,
Bella Achmadulina und Nika Turbina besonders nahe; subtil
erschließt Peter Gosse Gedichte aus dem Spätwerk
Adolf Endlers sowie „Sinn und Form“ der Lyrik
seiner Generationsgefährten Elke Erb, Helmut Richter,
Karl Mickel, Rainer Kirsch, Volker Braun und des um acht Jahre
jüngeren Richard Pietraß.
Dietmar Ebert, in: Thüringische Landeszeitung
(TLZ)
Nachricht vom
Leuchten der Dichtung
(...) In seiner Sammlung „Über
das allmähliche Verfertigen von Welt im Dichten“,
auch dazu da, den 75. Geburtstag des sächsischen Poeta
doctus, unermüdlichen Förderers und Ermutigers am
6. Oktober zu feiern, wendet er sich in Essays, Miniatur-Aufsätzen
und Anekdoten dem Hochamt des exegetischen Denkens zu: dem
Sichten und Begleiten einer Reihe Gedichte aus aller Welt,
aus der Mitte dieses überaus seltsamen Landes im Besonderen.
(...) Tiefernst zum Teil, oft mit feiner Verve und Humor –
so ist das Gedicht von Freund Jendryschik verlorengegangen,
was P. G. nicht hindert, es zu würdigen – begibt
sich der Sichter und Setzer auf die Spur jeder Stimme, erforscht,
bedenkt die „Verfertigung von Welt“ in der Arbeit
der Kollegen und Weitentfernten. ... Nachdichtungen (werden)
kommentiert, beiläufig von der Begegnung mit der Creme
der Weltpoesie (Alberti, Hikmet, Jessenin) berichtet. Gewissermaßen
beschreibt Gosse so das Rondell seiner synästhetischen
Arbeitsweise, von den herrlich-wuchtig-verzagten Zeichnungen
Volker Stelzmanns flankiert, die die „Welt im Dichten“
kommentieren und runden.
Der Radius für den Kreis dieser Texte bleibt Peter Gosses
staunende, euphorische Liebe zur Poesie: mit rollendem Aug’,
aufspringender Freude sieht man ihn etwa über Volker
Brauns „Italienische-Nacht“-Furioso gebeugt! Dass
er diese Liebe mit uns teilt, ist ein Glücksfall und
nährt den Glauben daran, man könne jede, auch diese
sich wüst überkullernde, aushöhlende Zeit,
mit dem Leuchten, der zaubrischen Würde von Gedichten
überstehen. „… es ist noch die (…)
Zeit frohen Hoffens“, ruft Gosse im Angesicht des Braun’schen
Gelingens – auf das Poem, das sich darin entrollende
Liebesspiel paritätisch gemünzt, ist es die Quintessenz,
an die sich Lyrik-Connoisseure zu halten haben, zugleich.
André Schinkel in: Palmbaum, Heft 2/2013
(...) Nun, anlässlich seines 75. Wiegenfestes lädt
er nicht zur Feier seiner Person, sondern schickt er sich
an, andere zu feiern, indem er uns zeigt „Wie sie es
machen die Dichter“. Das hat er seit seinen poetischen
Anfängen bereits während seines Moskauer Studiums
der Hochfrequenztechnik, bei seinen frühen Fixsternen
Paul Eluard und Walt Whitman wie bei den lokalen Helden großer
Lyrikarenen studiert, mit denen er, wie mit Bella Achmadulina
und Jewgeni Jewtuschenko bis in jüngste Zeit verbunden
blieb.
Wo er das tut? In dem Essaybändchen Über das allmähliche
Verfertigen von Welt im Dichten, mit Zeichnungen Volker Stelzmanns
erschienen in der bibliophil wohlfeilen Reihe Ornament des
quartus-Verlags. Da versammelt er sie, die Alten wie Petrarca,
Walther von der Vogelweide, Hölderlin und Li Tai Bo,
Klassiker der Moderne wie Rafael Alberti, Pablo Neruda, Sergej
Jessenin und Nazim Hikmet. Und die Generationsgefährten
der Sächsischen Dichterschule Mickel, Endler, Braun.
und Rainer Kirsch.
In der Kürze der Texte, deren Kernname rot über
dem jeweiligen Titel prangt, kann natürlich nicht umfassend
analysiert werden. Meist handelt es sich um ein- bis zweiseitige
Sonden und Schlaglichter, die kurzweilig Gosses Hang zur spontanen
und ansteckenden Begeisterung entsprechen. Der Feinschmecker
spürt Nuancen nach und macht, ganz Poesielehrer, der
er am Literaturinstitut in den achtziger und neunziger Jahren
war, großzügig Ruhmavancen. Besonders Thomas Rosenlöcher,
Kerstin Hensel und Roza Domascyna erhielten von ihm, der bei
Georg Maurer lernte, das Rüstzeug für ihre eigene
dichterische Entfaltung und unverwechselbare Stimme.
Wohl dem, der diesen bisweilen hochreflexiven, erfindungs-
und fintenreichen Wortschatz, diesen weltwachen Sprachfluss
und erlebnissatten Lebensstrom in seinem Buchregal weiß.
Gosse lesen, heißt erleben, wie Daseinsdinge auf den
Knackpunkt und ins Schwingen, Schweben und Verschweben gebracht
werden. Unter dem macht er es nicht, der sächsische Bukoliker
und plebejische Klassizist, dem der eigene Nabel nicht mehr
gilt als die Nabelschnur der Menschheit und die Hutschnur
der Völker. Auf dieser Basis ist mit ihm gut Kirschenessen
und Weingeist verströmen. Die Bonhommie dieses analysescharfen
Denkvergnügten, seine Renaissancenatur mit barocken Zügen,
macht ihn zum geliebten Freund. (...)
Richard Pietraß, in: Neues Deutschland (ND)
vom 5./6.10. 2013
Konzis wird uns auf einer oder
einer halben Seite die weltliterarische Eigenart von Petrarca,
Hölderlin, Li Tai Bo, Whitman, Neruda, Jessenin nahegebracht.
Der Freundeskreis wird vorgestellt: Maurer, Mickel, Endler,
Braun, Pietraß..., Begegnungen mit Poeten wie Rafael
Alberti,. Jewgeni Jewtuschenko werden erinnert. Gosses Wirken
als Lyrikdozent am Literaturinstitut "Joh. R. Becher"
mag erst recht seine Fähigkeit zum Glänzen gebracht
haben, am signifikanten Detail - sei es ein Zeilensprung oder
eine Akzentverschiebung - die Originalität einer Dichtung
aufzuweisen: Dichtung als "Empfindungskorrelat des eigentümlich
geschauten und durchschauten Weltganzen". Wäre der
Begriff nicht immer noch arg belastet, könnte man Gosse
als Manieristen bezeichnen - als realistischen Manieristen,
der menschliche Daseinslüste und Daseinsnöte in
sprachartistischen Balancen/Bilanzen präsentiert. Das
freilich auch mit Blick auf den Malerfreund Stelzmann ...
Jürgen Engeler, in: Marginalien. Zeitschrift für
Buchkunst und Bibliophilie, Heft 3/2013

|